Solarinstitut Schweiz
Schluss mit Billigangeboten!
Wir zeigen Ihnen, was Ihre Solaranlage wirklich kostet. Ohne versteckte Kosten oder Preisänderungen
- Höchste Qualität
- Zertifizierte Partner
- Kostenlos & unverbindlich
- Kein Telefonspam



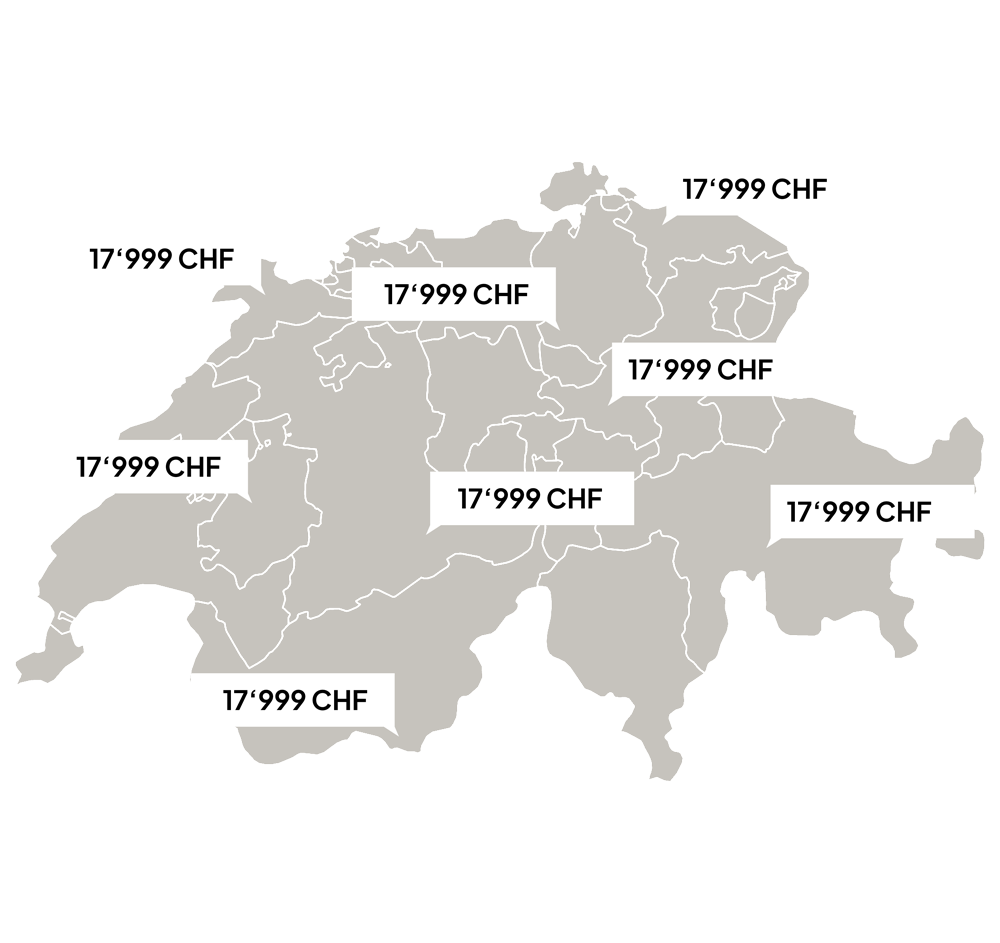
Solaranlagen Vergleich
Was ist der Preis in meiner Region?
Jetzt den Besten Preis-Leistungs Partner für Ihr Dach in genau Ihrer Region finden.
Unser Versprechen an Sie
„Total Quality: Wir messen die Servicequalität und Kundenzufriedenheit. Der Angebotsvergleich ist für Sie kostenlos und bietet diverse Vorteile. Wir vermitteln täglich Tausende hochqualitative Fachfirmen an
Eigenheimbesitzer:innen an und können ihnen somit Qualität garantieren.”
Geschäftsführung
Schnell & unverbindlich
Lokale Qualität
Preissturz und keine MwSt.
Große Expertise
Hier Online-Solar-Rechner starten und einfach Angebote vergleichen
Wir vermitteln täglich Tausende hochqualitative Fachfirmen an Eigenheimbesitzer:innen an.
In 3 Schritten zum ersten Auftrag
So funktioniert’s – in 3 Schritten einfach zur eigenen Solaranlage
1. Online Formular absenden
2. Passende Anbieter vergleichen
3. Die beste Offerte finden & sparen
Nur qualitative Partner
Als unabhängige Vergleichsplattform arbeiten wir ausschließlich mit ausgewählten Solarpartnern, die höchste Qualitätsstandards erfüllen. So stellen wir sicher, dass die Schweiz nicht auf Billigangebote setzt, sondern auf nachhaltige und langlebige Solarlösungen.
Alle Anlagengrößen
Blitzschnelle Offerten
Etablierte Schweizer Unternehmen
Beste Qualität
Viele Finanzierungsmöglichkeiten
Jederzeit anpassbar
Wir vermitteln seit 10 Jahren Fachfirmen an Eigenheimbesitzer:innen
Monatlich entstehen in unserem Netzwerk bis zu 12.000 Kundenanfragen, die wir ausschließlich mit unserem eigenen Team bearbeiten. Dies ermöglicht es uns, unseren hohen Qualitätsstandard zu wahren. Wann dürfen wir auch Sie von unseren Leistungen überzeugen?

Häufig gestellte Fragen
Für Ihre offenen Fragen steht Ihnen unser Team jederzeit zur Verfügung. Die häufigsten Fragen und Antworten haben wir hier schon einmal zusammengefasst:
Die Preise für Photovoltaikanlagen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Laut einer eigenen Umfrage unter Partnerfirmen von solarinstitut.ch liegt der Durchschnittspreis pro Kilowattpeak einer schlüsselfertig installierten Anlage derzeit bei netto 1.200 bis 1.400 Euro, was einem Rückgang von etwa 50 Prozent im Vergleich zu 2013 entspricht. Größere Anlagen werden tendenziell wieder häufiger installiert, um die verfügbare Fläche besser zu nutzen.
Für größere PV-Anlagen beträgt der Preis oft etwa 1.200 Euro pro kWp. Die Investition in eine Photovoltaikanlage bleibt daher attraktiv, insbesondere vor dem Hintergrund steigender Strompreise und anhaltend niedriger Zinsen, die Renditen von bis zu 8% ermöglichen. Ein Angebotsvergleich ist aufgrund der großen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Anbietern ebenfalls lohnenswert.
Die Gesamtkosten einer Photovoltaikanlage hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Kosten für Module, Wechselrichter und Montage. Im Durchschnitt belaufen sich die Montagekosten auf 150 bis 220 Euro pro Kilowattpeak installierter Leistung. Zusätzlich können Planungskosten anfallen, insbesondere bei größeren Dachflächen.
Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen und zu vergleichen, um die besten Konditionen zu erhalten. Dieser Vergleich kann dazu beitragen, bis zu 30 Prozent der Kosten für eine Photovoltaikanlage zu sparen. Die Preise für Photovoltaikmodule sind in den letzten Jahren erheblich gesunken, was zu einer insgesamt günstigeren Anschaffung von PV-Anlagen führt.
Die Preisentwicklung von PV-Anlagen zeigt einen kontinuierlichen Abwärtstrend, wobei die Anschaffungskosten in den letzten Jahren um etwa die Hälfte gesunken sind. Auch der Preisindex von pvxchange zeigt einen deutlichen Rückgang der Modulpreise im letzten Jahr.
Der von einer Photovoltaikanlage erzeugte Strom kann entweder ins öffentliche Stromnetz eingespeist oder selbst genutzt werden.
Beim Eigenverbrauch wird der erzeugte Solarstrom direkt im Haus verwendet. Jedoch entspricht die produzierte Menge nicht immer dem tatsächlichen Bedarf, da die Sonneneinstrahlung tagsüber am höchsten ist, während der Strombedarf oft morgens und abends besteht. Überschüssiger Solarstrom wird daher ins Netz eingespeist, während bei geringer Produktion zusätzlicher Strom vom Energieversorger bezogen wird. Der Eigenverbrauch liegt normalerweise zwischen 20 und 30 Prozent.
Um den Solarstrom optimal zu nutzen, werden Stromspeicher angeboten. Diese ermöglichen eine flexible Nutzung des tagsüber gewonnenen Stroms und optimieren den Eigenverbrauch.
Viele Verbraucher interessieren sich zunehmend für Komplettanlagen, die aus Photovoltaikmodulen und einem Stromspeicher bestehen. Dies wird durch sinkende Einspeisevergütungen und steigende Strompreise immer wirtschaftlicher.
Stromspeicher können auch für Betreiber älterer Anlagen interessant sein, da diese nach dem EEG weiterbetrieben werden können, jedoch keine feste Vergütung mehr erhalten. Die Speicherung des Solarstroms bietet mehr Unabhängigkeit und Sicherheit vor steigenden Strompreisen.
Es gibt verschiedene Solarspeichersysteme auf dem Markt, wobei Lithium-Ionen-Speicher aufgrund ihrer Lebensdauer und Effizienz bevorzugt werden.
Die Anzahl installierter Stromspeicher in Deutschland steigt kontinuierlich an. Deutsche Anbieter wie sonnen, SENEC, E3/DC, Varta und Solarwatt gehören zu den führenden Herstellern weltweit.
Die Kosten eines Solarstromspeichers hängen von der Speicherkapazität ab und liegen durchschnittlich bei etwa 1.000 Euro pro Kilowattstunde. Durch die Erhöhung des Eigenverbrauchs können PV-Anlagen mit Speicher erhebliche Einsparungen bei den Stromkosten erzielen.
Ob sich die Anschaffung eines Speichers lohnt, hängt vom individuellen Stromverbrauchsprofil ab. Eine Beratung durch Fachleute kann dabei helfen, die beste Investitionsentscheidung zu treffen.
Eine Photovoltaik-Anlage wandelt die Lichtenergie der Sonne mithilfe von Solarzellen in elektrische Energie um. Diese Anlage besteht aus mehreren Solarmodulen, die wiederum aus Photozellen bzw. Solarzellen zusammengesetzt sind. Ein Photon, auch als Lichtquant oder Lichtteilchen bekannt, hat keine Masse, trägt aber Energie.
Wenn ein Photon auf die Halbleiter der Photozelle aus Silizium trifft, werden Elektronen aus der Struktur herausgelöst und somit freibeweglich, was als photoelektrischer Effekt bezeichnet wird. Das Metall, das der Siliziumschicht zugefügt wird, fungiert als Elektronenspender. Im Grenzbereich zwischen Metall und Silizium binden sich die freien Elektronen aus dem Elektronenspender locker an die freien Fehlstellen in der unteren Schicht und bilden elektrisch eine neutrale Zone, den “p-n-Übergang”, der auch als “schwebender Zustand” bezeichnet wird.
Da nun oben in der Zelle ein Elektronenüberschuss und unten ein Elektronenmangel herrscht, entsteht zwischen den Kontaktflächen ein ständig vorhandenes elektrisches Feld. Elektronen und Fehlstellen streben permanent nach einem natürlichen Ausgleich.
Wenn Licht auf die Solarzelle fällt, überträgt die Energie der Lichtteilchen Elektronen aus ihrer Bindung, wodurch diese als frei bewegliche Teilchen zur Verfügung stehen. Einige dieser Elektronen wandern zu den Frontkontakten, was zu einer elektrischen Spannung führt.
Der Begriff “Photovoltaik” leitet sich aus dem Griechischen für “Licht” und der Einheit für elektrische Spannung, dem Volt (benannt nach Alessandro Volta), ab. Die Nennleistung von Photovoltaikanlagen wird in kWp angegeben und bezieht sich auf die Leistung unter Testbedingungen, die der maximalen Sonnenstrahlung in Deutschland entsprechen. Der jährliche Ertrag wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen.
In Deutschland sind grundsätzlich alle Regionen für die Nutzung von Solarenergie geeignet. Photovoltaikanlagen können sowohl auf Schräg- als auch auf Flachdächern installiert werden. Es ist wichtig, dass die Fläche im Verlauf des Tages möglichst wenig verschattet wird, da Verschattungen den Solarstromertrag verringern können. Je größer die verschattete Fläche ist, desto geringer ist der Ertrag der PV-Anlage.
Besonders geeignet sind Flächen, die nach Süden, Südosten oder Südwesten ausgerichtet sind. Eine verfügbare Sonnenfläche von mindestens 20 bis 45 Quadratmetern wird empfohlen. Die durchschnittliche Größe von Photovoltaikanlagen auf Ein- und Zweifamilienhäusern liegt zwischen 40 und 80 Quadratmetern.
Der optimale Einfallswinkel der Sonnenstrahlen auf die PV-Module variiert je nach Region. In Deutschland wird eine Dachneigung von 30° bis 45° empfohlen. Flachdächer ermöglichen eine flexible Ausrichtung der Module in jede beliebige Himmelsrichtung durch entsprechende Aufständerung.
Photovoltaikanlagen bestehen hauptsächlich aus Photovoltaik-Modulen, die Sonnenlicht in Solarstrom umwandeln. Auf dem Markt sind drei dominierende Arten von Modulen erhältlich: monokristalline, polykristalline und Dünnschichtmodule. Diese unterscheiden sich unter anderem in Herstellungsweise, Wirkungsgrad, Preis und Gewicht. Zusätzlich gibt es Solardachziegel, die herkömmliche Ziegel oder Dachwannen ersetzen und neben der Stromproduktion auch dämmende und abdichtende Funktionen haben.
Die PV-Module erzeugen Gleichstrom, der mittels eines Wechselrichters in Wechselstrom umgewandelt wird. Wechselrichter überwachen das Stromnetz und optimieren die Leistung der PV-Module unter aktuellen Bedingungen.
Der erzeugte Solarstrom kann entweder ins öffentliche Stromnetz eingespeist oder selbst verwendet werden. Bei Einspeisung ins Netz erhält man eine gesetzlich garantierte Einspeisevergütung. Um den Eigenverbrauch zu steigern, kann ein Solarspeicher installiert werden, der überschüssigen Solarstrom speichert und zu einem späteren Zeitpunkt nutzt.
Für die Messung des Stromverbrauchs und -ertrags sind verschiedene Zähler erforderlich. Das neue EEG 2023 vereinfacht einige Aspekte der Zähleranforderungen. Ein Ertragszähler misst den produzierten Solarstrom, ein Bezugszähler misst den zusätzlichen Stromverbrauch aus dem Netz, und ein Einspeisezähler gibt an, wie viel Solarstrom ins Netz eingespeist wird. Ein Zweirichtungszähler kombiniert Bezugs- und Einspeisezähler.
Je nach Qualität des Moduls, geographischer Lage des Standorts und Eigenschaften der Fläche, auf welcher die Photovoltaik-Anlage installiert wird, können pro kWp (also einer Modulfläche von 6 bis 9 qm) installierter Photovoltaik-Leistung üblicherweise zwischen 800 kWh und über 1000 kWh Solarstrom pro Jahr erzeugt werden.
Zum Vergleich: Eine vierköpfige Familie verbraucht im Durchschnitt ca. 3.500 kWh Strom pro Jahr. Wie viel Ertrag auf Ihrem Dach mit einer PV-Anlage erzeugt werden kann, sagt Ihnen ein qualifizierter Photovoltaik-Anbieter. Mit einem konkreten Photovoltaik-Angebot kann dann auch die Rentabilität der PV-Anlage optimal kalkuliert werden.
Durch solarinstitut.ch können Sie ohne großen Suchaufwand bewährte Solaranbieter finden und Angebote für Photovoltaikanlagen vergleichen. Mit diesem Vergleich konkurrierender Anbieter können Sie sich für das beste Paket aus Preis und Leistung entscheiden.
Um sicherzustellen, dass Ihre Solaranlage optimale Erträge liefert, ist es entscheidend, dass das System von erfahrenen Solarteuren installiert wird, die Ihnen im Bedarfsfall auch einen zuverlässigen Service bieten können.
Gute Photovoltaik-Hersteller bieten in der Regel mindestens 10 Jahre Produktgarantie auf ihre Solarmodule und gewähren zusätzlich eine Leistungsgarantie für die Solarausbeute von mindestens 20 Jahren. Im Falle eines Garantiefalls kann es vorteilhaft sein, die Garantie bei einem deutschen Photovoltaik-Unternehmen geltend zu machen, anstatt bei einem Unternehmen in Asien.
Wenn Sie diese Punkte beachten, sind Sie auf der sicheren Seite und können bald zu den Gewinnern im Bereich Solaranlagen zählen.
